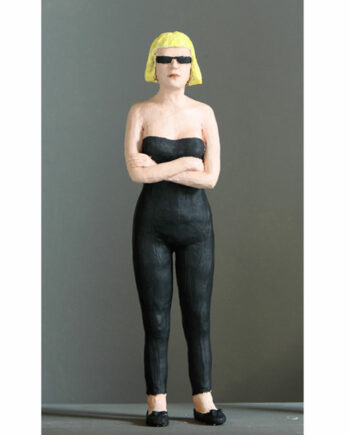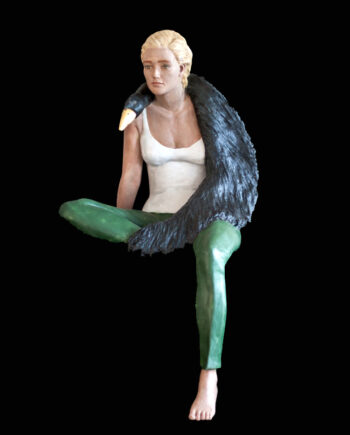Václav Hejna – Klaviatur der Zauberformeln – 1956-1964
9.800,00 €
Künstler: Václav Hejna
Titel: Klaviatur der Zauberformeln
Entstehungsjahr: 1956 – 1964
Technik: Holz bemalt
Größe: 150,9 x 36,0 x 5,5 cm
Kennzeichnung: Klaviatura zaglinadel, V Hejna 56-64 (Adressetikett der Galerie Creuze, Paris)
Artikelnummer: 2021000247
1 vorrätig
zzgl. Versandkosten